
Der Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad ist eine wichtige Größe für technische Vorgänge aller Art. Er ist so etwas wie ein zentrales Gesetz für Energie- und Leistungswandlung, das allerdings öffentlich kaum in Erscheinung tritt – obwohl der Wirkungsgrad maßgeblich zur CO2-Reduktion und somit zur Bremsung des Klimawandels betragen kann. Wäre der Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors nur einen einzigen Prozentpunkt höher, wäre der CO2-Ausstoss allein in Deutschland um mehrere Millionen Tonnen reduziert. Aber das ist leider kaum mehr möglich, so wenig 1 % Wirkungsgradsteigerung auch klingen mag. Also: wo liegen aktuell große Wirkungsgradgewinne?

Die Definition des Wirkungsgrades ist einfach: Eine gewonnene Energie wird mit einer aufgebrachten Energie verglichen. Das setzt also voraus, dass eine Transformation von einer Energieform in eine andere vorliegt. Also eine Art Energiewandler, am Beispiel Verbrennungsmotor von chemischer (Benzin) in kinetische Energie (Bewegung). Die gewonnene Energie wird durch die aufgebrachte Energie geteilt. Daraus ergibt sich eine Zahl zwischen 0 und 1 (physikalischer Buchstabe Eta) bzw. zwischen 0 und 100 %. Der Wirkungsgrad macht also verschiedene Energiewandler vergleichbar. Statt Energie kann auch Leistung eingesetzt werden, die bis auf den Divisor Zeit mit Energie gleichgesetzt werden kann.
In der Theorie erhält man den maximalen Wirkungsgrad, wenn die gewonnene Leistung genauso groß ist wie die aufgebrachte Leistung. Das wäre ein Wirkungsgrad von 1 bzw. 100 %. Mehr geht nicht – schließlich besagt ein Naturgesetz, dass man nie mehr herausbekommen kann als man hineinsteckt. In der Realität gibt es beim Wandeln von Energie immer Verluste. Warum betreibt man dann solche Energiewandler überhaupt? Die gewonnene Energie hat für den Nutzer einen höheren Wert als die aufgebrachte. Elektrische Energie gilt übrigens als die hochwertigste. Aus ihr kann man relativ leicht und meist effizient (bis auf das Licht) fast alle anderen Energieformen gewinnen.
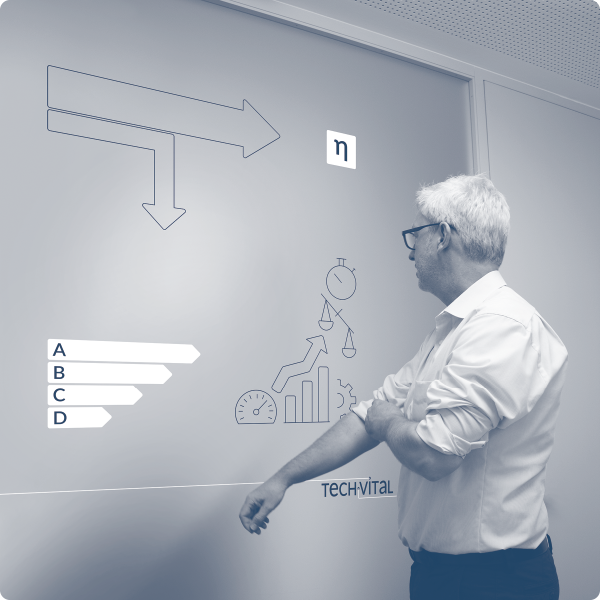 Leider gibt es auch Prozesse der Energieumwandlung, die selbst in der Theorie nicht an 100 % herankommen. Eine Windturbine hat zum Beispiel einen maximalen Wirkungsgrad von etwa 60 %. Besser kann Windströmung nicht in Elektrizität umgewandelt werden. Der allseits bekannte Ottomotor kommt auf einen maximalen Wirkungsgrad von ca. 40 %. Dabei spricht man hier auch vom technischen Wirkungsgrad, also dem maximal möglichen Wirkungsgrad für diese spezifische Form der Energiewandlung. In der Realität müssen bei beiden Maschinen nochmal 10 % Punkte abgezogen werden – wir kommen also auf reale Wirkungsgrade von 50 % bei Windturbinen und nur noch 5 % bei Verbrennungsmotoren. Trotz dieser eher ungünstigen Wirkungsgrade haben beide Technologien eine große technische Bedeutung erreicht. Die Wasserturbine und der batterieelektrische Antrieb wären mit realen Wirkungsgraden von über 90 % die wesentlich effizienteren Energiewandler. Aber Wasserkraft und -energie ist begrenzt und Elektromobilität erforderte gute Batterien, um mobil zu funktionieren.
Leider gibt es auch Prozesse der Energieumwandlung, die selbst in der Theorie nicht an 100 % herankommen. Eine Windturbine hat zum Beispiel einen maximalen Wirkungsgrad von etwa 60 %. Besser kann Windströmung nicht in Elektrizität umgewandelt werden. Der allseits bekannte Ottomotor kommt auf einen maximalen Wirkungsgrad von ca. 40 %. Dabei spricht man hier auch vom technischen Wirkungsgrad, also dem maximal möglichen Wirkungsgrad für diese spezifische Form der Energiewandlung. In der Realität müssen bei beiden Maschinen nochmal 10 % Punkte abgezogen werden – wir kommen also auf reale Wirkungsgrade von 50 % bei Windturbinen und nur noch 5 % bei Verbrennungsmotoren. Trotz dieser eher ungünstigen Wirkungsgrade haben beide Technologien eine große technische Bedeutung erreicht. Die Wasserturbine und der batterieelektrische Antrieb wären mit realen Wirkungsgraden von über 90 % die wesentlich effizienteren Energiewandler. Aber Wasserkraft und -energie ist begrenzt und Elektromobilität erforderte gute Batterien, um mobil zu funktionieren.
Was bedeutet das für die Produktentwicklung?
Ganz einfach: Jedes Nachfolgeprodukt sollte im Vergleich zum Vorgänger einen höheren Wirkungsgrad aufweisen. Diese Anforderung steht selbstverständlich ganz oben im Lastenheft. Betrachten wir beispielhaft einige Systeme, mit denen das sehr gut gelungen ist.
Große Maschinen habe in der Regel höhere Wirkungsgrade als kleine Maschinen. Deshalb kann es Sinn machen, ein großes Gaskraftwerk zu betreiben und den Strom dann batterieelektrisch im Auto in Bewegung umzuwandeln, anstatt das Gas im Ottomotor klassisch zu verbrennen. Zudem lassen sich auch die Abgase von großen, konstant laufenden Maschinen deutlich besser reinigen als von kleinen unter wenig konstanten Bedingungen laufenden Motoren im Auto.
Eine weitere Möglichkeit, an Wirkungsgrad zu gewinnen, ist ein technologischer Sprung im Energiewandler. Das haben wir in den letzten 20 Jahren mit Elektromotoren erlebt. Haushaltsgeräte wie Staubsauger oder elektrische Handwerkzeuge wie Bohrmaschinen wurden von „Bürstenmotoren“, wie es sie seit über 100 Jahren gab, zu bürstenlosen Antrieben weiterentwickelt. Die mechanische Kommutierung ist einer elektronischen gewichen, das allein hat einige Prozentpunkte Wirkungsgrad gebracht. Die Möglichkeit, die elektronische Kommutierung noch mit Software an die Anforderung anzupassen, verringert Verluste um einen weiteren Beitrag.
 So kommt ein bürstenloses Antriebssystem auf Wirkungsgrade von ca. 90 % – im Gegensatz zum alten Bürstenmotor mit 75 bis 80 %. Mit den immer besseren und leichteren Akkus und dem bürstenlosen Elektromotor wurde es möglich, heute nahezu jedes Elektrogerät ohne Kabel anbieten zu können. Akkustaubsauger, Akkuschrauber oder Akkusägen gibt es mit guter Leistung und vernünftiger Laufzeit. Auch Elektrofahrzeuge profitieren vom guten Wirkungsgrad der dort eingesetzten bürstenlosen Motoren sowie passenden Batterien und spezifischer Elektronik. Der Wirkungsgradsprung ist hier nochmal deutlich größer, da die Messlatte des Verbrennungsmotors mit 35 % eher tief liegt.
So kommt ein bürstenloses Antriebssystem auf Wirkungsgrade von ca. 90 % – im Gegensatz zum alten Bürstenmotor mit 75 bis 80 %. Mit den immer besseren und leichteren Akkus und dem bürstenlosen Elektromotor wurde es möglich, heute nahezu jedes Elektrogerät ohne Kabel anbieten zu können. Akkustaubsauger, Akkuschrauber oder Akkusägen gibt es mit guter Leistung und vernünftiger Laufzeit. Auch Elektrofahrzeuge profitieren vom guten Wirkungsgrad der dort eingesetzten bürstenlosen Motoren sowie passenden Batterien und spezifischer Elektronik. Der Wirkungsgradsprung ist hier nochmal deutlich größer, da die Messlatte des Verbrennungsmotors mit 35 % eher tief liegt.
Wie sieht es mit der Brennstoffzelle aus?
Die Brennstoffzelle kann maximal 60 % des zugeführten Gases (z. B. Wasserstoff) in elektrische Leistung wandeln. Das ist schon mal viel besser und deutlich effizienter als ein Verbrennungsmotor. Allerdings ist mit dem E-Antrieb in den letzten Jahren ein noch effizienteres System auf den Markt gekommen. Die hohen Verluste bei der Erzeugung von Wasserstoff ziehen den Gesamtwirkungsgrad eines Brennstoffzellen-Autos zudem etwa auf Verbrennerniveau herunter. Es werden sich daher wohl nur schwer Szenarien finden lassen, in denen ein Brennstoffzellen-Antrieb in Zukunft sinnvoll betrieben werden kann. Auch wenn es immer wieder versprochen wird.
Wenn die technologische Entwicklung einen Sprung macht – man darf dann auch von einer Innovation sprechen – steigt der Wirkungsgrad für eine Anwendung deutlich an. Bleibt man in der gleichen Technologie, so gelingen Verbesserungen des Wirkungsgrads trotz hohen Aufwands nur in kleinen Maße.
Wie man auch ohne Technologiesprung viel Energie einsparen kann (z. B. bei Kühlschränken, deren Kältepumpen seit vielen Jahrzehnten im Wirkungsgrad kaum mehr verbessert werden konnten), behandeln wir in einem anderen Beitrag:
